Jochens SOZIALPOLITISCHE NACHRICHTEN

Sehr ausführliches gutes Interview von Bernd Stegemann vom Trägerverein von Aufstehen! durch Paul Schreyer *) über die Aufstehen-Bewegung, über Ausgrenzung, Doppelmoral und das Fehlen einer linken Erzählung, „die die soziale Frage ins Zentrum stellt“auf Telepolis, dort auch lesenswerte Diskussion: https://www.heise.de/tp/features/Der-Klassenbegriff-ist-planmaessig-zerstoert-worden-4336430.html
Auszüge:
Herr Stegemann, Sie sind seit 20 Jahren Dramaturg am Theater, außerdem Professor an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, Autor von politischen Sachbüchern und seit 2018 auch Vorsitzender des Trägervereins der Aufstehen-Bewegung. Zunächst: Wie ist zur Zeit der Stand bei „Aufstehen“? Wie geht es weiter nach dem Rückzug von Sahra Wagenknecht aus der Spitze der Sammlungsbewegung?
Bernd Stegemann: Wagenknecht zieht sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem organisatorischen Tagesgeschäft von Aufstehen zurück, so wie sie auch nicht mehr als Fraktionsvorsitzende der Linkspartei kandidieren wird. Sie hat Aufstehen gegründet und wird auch weiterhin Teil der Bewegung bleiben, die sie nach Maßgabe ihrer Kräfte solidarisch unterstützt.
Wie geht es nun weiter?
Bernd Stegemann: Brecht würde sagen, damit sind wir endgültig in den „Mühen der Ebene“ angekommen. Nach der großen Anfangseuphorie, wo wir wirklich überrascht und sehr erfreut waren, haben sich viele Detailprobleme aufgetürmt, überwiegend organisatorischer Natur, die wir jetzt versuchen müssen zu lösen.
Und das ist natürlich sehr schwer bei einer Bewegung, die nur aus Ehrenamtlichen und Freiwilligen besteht. Vom Programmieren der Webseite bis zur Verwaltung der Daten, der Finanzen und so weiter ist das ein Wust an Arbeit, der momentan noch keine entsprechende Organisationsstruktur gefunden hat, um sie wirklich zu bewältigen.
Gibt es in diesem Jahr größere Aktionen?
Bernd Stegemann: Ja, die gibt es laufend. Ende Februar fand ein großes Aktionscamp in Dortmund statt.
Am 14. März gab es eine große Veranstaltung in Hamburg, wo Sahra Wagenknecht auftrat, außerdem in Leipzig, es gibt in Berlin ein großes Treffen der dortigen Gruppen im April.
Aufstehen lebt in über 200 lokalen Gruppen, die sich alle regelmäßig treffen. Auf der konkreten Ebene läuft es eigentlich verblüffend gut, auf der Ebene der Gesamtorganisation schleppt’s.
Vereinbarkeit von offenen Grenzen mit einem hochdifferenzierten Wohlfahrtsstaat
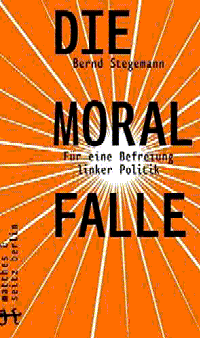
Kommen wir zu Ihrem neuen Buch „Die Moralfalle“. Ich möchte gerne mit dem Titel anfangen, weil vielleicht nicht jeder weiß, was damit gemeint ist. Sie schreiben: „Die Moralfalle bezeichnet eine Kommunikationsstrategie, die vermeintlich der moralischen Seite nutzt, deren Folgen die verfochtenen Werte jedoch schwächen.
Das Dilemma besteht darin, dass es mit den humanistischen Werten Europas unvereinbar ist, Menschen leiden oder gar sterben zu lassen, zugleich aber die Aufnahme aller Menschen in Not zu einer Zerstörung des humanistischen Europa führen würde.“
Am Ende des Buch heißt es: „Um die utopische Kraft einer internationalen Solidarität in Europa zu bewahren, muss sie in einer anderen Politik umgesetzt werden als in der einfachsten und darum gefährlichen Form einer Open-Border-Politik, die jede Steuerung unterbinden will.“ Denn das sei eine Forderung, die nicht bedenke, „wie ihre Realisierung das Fundament der eigenen Werte zerstört.“
Konkret gefragt: Was wird zerstört – wie ist das gemeint?
Bernd Stegemann: Die Werte, denen das aufgeklärte, abendländische Europa folgt, das der französischen Revolution und dem sozialen Gedanken verpflichtet ist, sind nicht vom Himmel gefallen. Das sind Werte, die einerseits in der Philosophie vorgedacht wurden, aber andererseits erst durch harte, konkrete, soziale Kämpfe Wirklichkeit geworden sind.
Dahinter stehen eine 150-jährige Tradition der Sozialdemokratie, ein Bildungssystem, das diese Werte vermittelt, ein ethisches Gerüst und so weiter.
Das sind alles materielle Bedingungen dafür, dass diese Werte nicht nur Sonntagspredigten füllen, sondern im gesellschaftlichen Alltag zur Wirklichkeit werden. Es ist also ein komplexes Gefüge, das nicht beliebig irritierbar ist.
Das haben wir in allen großen Ausnahmesituationen gesehen. Der Faschismus, der Deutschland ab 1933 regierte, hat diese Werte in relativ kurzer Zeit in ihr Gegenteil verkehrt. Also, diese Werte sind nicht ewig und sie sind auch nicht vom Himmel gefallen, sondern sie müssen täglich neu bestätigt, beglaubigt, gelernt und verteidigt werden. Sie sind angreifbar.
Was heißt das konkret bezogen auf die Zuwanderung?
Bernd Stegemann: Zuwanderer müssen integriert werden in diese Komplexität, damit es nicht zu dauerhaften Parallelgesellschaften kommt.
Es kann nicht sein, dass diese Werte relativiert werden, egal von welcher Seite, indem man zum Beispiel sagt, die Scharia ist auch eine Gesetzgebung mit jahrhundertelanger Tradition, die Gültigkeit beanspruchen darf.
Dafür sind Abstimmungsprozesse erforderlich, die konkret stattfinden müssen. Und dabei geht es natürlich auch darum, ab wann so ein kompliziertes System überfordert ist.
Die große Frage, die ich immer allen Open-Border-Aktivisten stelle, ist: Erklärt mir doch bitte mal, wie ihr offene Grenzen für alle vereinbaren wollt mit einem hochdifferenzierten Wohlfahrtsstaat. Wie soll das gehen, praktisch?
Welche Antworten bekommen Sie da?
Bernd Stegemann: Keine! Dann bekomme ich die Moral um die Ohren gehauen. Denn die Grenzenlosigkeit sei doch ein absoluter Wert, und ich würde mit der Verteidigung des Wohlfahrtsstaates dessen Werte verraten.
Das ist für mich die Moralfalle in Reinkultur. Man tut so, als wäre der Wert eine abstrakte Größe, die ich vor mir hertragen kann, und dann wird alles gut.
Dabei wird ignoriert, dass der Wert nur dann Relevanz hat, wenn er auch lebenspraktisch Wirklichkeit wird.
Sie schreiben in ihrem Buch: „Moralismus ist auf einer psychologischen Ebene vor allem eine Selbstimmunisierung gegen Kritik.“ Können Sie das erklären?
Bernd Stegemann: Meine Kritik besteht darin, dass die Open-Border-Fraktion nicht in der Lage ist, zu erklären, wie das mit dem Wohlfahrtsstaat vereinbar sein soll. Stattdessen wird eine Moralkeule herausgeholt oder ein Moralballon steigen gelassen, mit dem man denkt, man hätte sich alle Probleme vom Hals geschafft, und wäre in seiner eigenen – letztlich unhaltbaren – Position trotzdem in der besseren Position.
Man immunisiert sich gegen jede Art von konkreter Kritik mit einer allgemeinen, leeren Abstraktion.
Sie konstatieren in Ihrem Buch auch eine Spaltung der Linken und erklären: „Die Beschäftigung mit allen ethnischen und sexuellen Minderheiten verspricht seit Jahren mehr öffentliche Aufmerksamkeit als die uncoole Klasse der Armen.“ So habe sich die Linke in einen identitätspolitischen und einen sozialpolitischen Flügel gespalten. Die Bezeichnung „links“ drohe „auseinanderzubrechen“. Aktuell fehle „eine linke Erzählung, die die soziale Frage ins Zentrum stellt“.
Die Ablehnung der Klassenfrage komme dabei inzwischen auch aus dem linken Milieu. Woran machen Sie diese Ablehnung fest?
Bernd Stegemann: Von der identitätspolitischen Seite wird gesagt, dass die beiden Merkmale „Gender“ und „Race“ zentral wären für alle Formen von emanzipatorischer Politik. Der dritte Aspekt, die „Klasse“, sei zu vernachlässigen, da sich dahinter in Wirklichkeit nur die Dominanz des weißen, heterosexuellen, patriarchalischen Arbeiters verberge.
Das heißt, die Klassenfrage wird auch zu einer identitätspolitischen Frage gemacht.
Also Klasse ist nicht mehr ökonomisch begründet, nicht mehr aufgrund von Arbeits- und Ausbeutungsverhältnissen, sondern wird auch auf Geschlecht, Hautfarbe und patriarchale Denkmuster reduziert.
Damit hat der identitätspolitische Flügel die Diskurshoheit über die Dreiheit der Diskriminierung übernommen. Denn diese Trias besteht aus der ethnischen Diskriminierung, der sexuellen Diskriminierung und der Diskriminierung durch Ausbeutung und Entfremdung.
Aber wenn alle drei Dinge nur identitätspolitisch gedacht werden, dann sind Ausbeutung und Entfremdung sozusagen unter die Räder gekommen.
Der blinde Fleck der Moralisten
Sie beschreiben einen „blinden Fleck der Moralisten“. Diese sähen nicht die tatsächlichen Ursachen gesellschaftlicher Konflikte, sondern würden eine „Fehlerhaftigkeit des Individuums“ behaupten. Moralische Urteile ersetzten die konkrete Analyse.
Sie sagen: „Der moralisierende Blick auf die Realität führt dazu, dass die Beschreibung eines Zusammenhangs mit dessen Herstellung oder Verteidigung verwechselt wird. Wer beschreibt, dass sich durch den Zuzug von Flüchtlingen die Lage auf dem sozialen Wohnungsmarkt, im Niedriglohnsektor und in den Schulen für den ärmeren Teil der Bevölkerung verschlechtert hat, produziert nicht diese Verschlechterung, sondern hebt die alltäglichen Probleme ins Licht der Öffentlichkeit.“
An der Benennung realer Probleme müssten doch eigentlich alle ein gemeinsames Interesse haben. Warum wird das Aussprechen dieser Dinge so kritisch gesehen?
Bernd Stegemann: Es haben eben nicht alle ein Interesse daran und daraus entsteht die verhängnisvolle Kollaboration. Der Unternehmer, dem die Wohnungen gehören, der hat natürlich kein Interesse daran, dass über Dinge wie Mietpreisbremse oder Schaffung von sozialem Wohnungsbau öffentlich diskutiert wird.
Und jetzt gibt es die verhängnisvolle Verbrüderung dieser Interessen einer Kapitalrendite mit einer Moralfraktion innerhalb der Linken, die sagt: Das sind auch gar nicht die wichtigen Themen, sondern wichtig sind die Themen der Minderheiten, der Identitätspolitik und so weiter.
Das ist das, was die Philosophin Nancy Fraser den „progressiven Neoliberalismus“ genannt hat. Darin wird das berühmte Freiheitsversprechen des Liberalismus in sein Gegenteil verkehrt, weil es nicht mehr um das zu befreiende und freie Subjekt geht, sondern um den freien Konsumenten und die freie Arbeitskraft.
Und beide sind natürlich überhaupt nicht frei, denn der Konsument ist durch seinen Geldbeutel beschränkt und die Arbeitskraft ist durch ihren Arbeitsvertrag beschränkt. Und außerdem sind vor allem die ethnisch diskriminierten Minderheiten besonders von der sozialen Ungleichheit betroffen, weswegen ihnen eine andere Sozialpolitik am meisten helfen würde.
„Die offenen Gesellschaften befinden sich in einer Phase der Refundamentalisierung“
Kommen wir zu einem anderen Punkt. Sie beschreiben in ihrem Buch, dass die Kommunikation zwischen den Lagern heute nicht auf Augenhöhe stattfände. Es sei vielmehr eine „urteilende Kommunikation, die nicht auf Veränderung, sondern auf Bestrafung“ ziele.
Sie zitieren den Soziologen Niklas Luhmann mit den Worten: „Praktisch gehen Moralisten davon aus, dass sie es mit Gegnern zu tun haben, die nicht überzeugt werden können.“ Was heißt das für eine Diskussion?
Bernd Stegemann: Das heißt, dass man Ausgrenzung für ein probates Mittel der Auseinandersetzung hält. Es gibt gerade im Theatermilieu eine nicht kleine Zahl von Menschen, die würden am liebsten ein Schild an ihr Theater hängen: „Keine Theatertickets und kein Zutritt für AfD-Wähler!“
Dann sage ich immer: Wenn wir daran glauben, dass wir hier Theater machen und damit irgendwie versuchen, die Welt etwas aufgeklärter, freundlicher und zivilisierter zu machen, dann müssten wir doch im Gegenteil sagen: „Freier Eintritt für AfD-Wähler!“
Was ist die Reaktion, wenn Sie so argumentieren?
Bernd Stegemann: Dann kommt die Empörung: Aha, „Nazis rein“, sagst du also. Ich sage: Ja, der Spruch „Nazis raus“ klingt toll, aber was ist die Wirkung?
Die Wirkung ist doch: Die, die das sagen, fühlen sich in dem Moment unglaublich mutig und schlau. Und die, die damit beschimpft werden, fühlen sich in ihrem Vorurteil bestätigt, dass die anderen sie tatsächlich nicht dabeihaben wollen.
Die Spaltung wird dadurch immer größer, weil die einen sich immer selbstsicherer und selbstgerechter fühlen in ihrer moralischen Haltung und die anderen fühlen sich in ihren Vorurteilen bestätigt. Darum führt das nirgendwo hin.
Abgesehen davon: Wo soll auch „raus“ sein? Man kann sie doch nicht in die Schweiz schicken, oder nach Holland.
Sie sagen, dass immer mehr Themen tabuisiert werden und auch von „den Guten“ nicht mehr angesprochen werden dürfen. Jeder, der es dennoch tue, gerate schnell in den Verdacht, selbst zu „den Bösen“ zu gehören, Stichwort „AfD-nah“.
So gerieten immer mehr Themen in den Bereich des Unsagbaren, wo Parteien wie die AfD sie nur aufzusammeln bräuchten, um dann große Aufmerksamkeit zu erregen. Im Buch schreiben Sie: „Die Realität ist zu einer unmoralischen Provokation geworden.“ Viele würden nach dem Dogma der mittelalterlichen Kirche verfahren, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Ist Ihrer Ansicht nach Dogmatismus ein Merkmal der heutigen Zeit?
Bernd Stegemann: Die offenen Gesellschaften befinden sich auf jeden Fall in einer Phase der Refundamentalisierung.
Was heißt das?
Bernd Stegemann: Was eine aufgeklärte Kultur ausgezeichnet hat, war Säkularisation und Rationalität. Das heißt, Argumente waren keine Glaubensfrage, sondern eine Frage der nachvollziehbaren Überzeugungen, im Sinne von: Ich lasse mich von einem Argument überzeugen oder ich habe ein besseres Gegenargument, was dann den Anderen überzeugt. Daran wird immer weniger geglaubt.
Die jeweiligen Communities schließen sich immer weiter gegenseitig ab: Alle, die etwas anderes sagen als wir selber, sind der Feind, und haben darum grundsätzlich nicht recht. Das ist eine Refundamentalisierung, die stattfindet, und zwar flächendeckend in der westlichen Welt.
Also von den USA, von den Trump-Wählern bis nach Europa. Man kann es überall sehen, auf dem rechten Rand ganz deutlich, aber leider auch auf einem bestimmten Sektor des linken Spektrums der Politik.
Würden Sie sagen, das ist in gewisser Weise ein Rückfall hinter die Prinzipen der Aufklärung?
Bernd Stegemann: Es ist auf jeden Fall ein Vergessen dieser Prinzipien.
Woher kommt das?
Bernd Stegemann: Viele versuchen ja, das gerade zu analysieren. Ich neige denen zu – Nancy Fraser habe ich schon erwähnt -, die sagen, es ist ein falscher Reflex auf die Zersetzung der Gesellschaft durch den Neoliberalismus.
Wenn so grundsätzlich Solidarität zerstört worden ist, und zwar sowohl auf der Überbau-Ebene – also dass die Erzählungen nicht mehr verbindend sind, dass die Weltanschauungen nicht mehr verbindend sind, sondern spaltend und vereinzelnd -, als auch auf der ökonomischen Ebene, wo jeder immer mehr zum Einzelkämpfer trainiert werden soll, um nicht unterzugehen -, also wenn sowohl der Überbau als auch die Basis zerrüttet sind, dann ist das wie eine Art psychologischer Übersprungshandlung, wenn man sagt: Ja, dann fundamentalisiere ich mich, da habe ich wenigstens noch eine Stammesgesellschaft, mit der ich auf Gedeih und Verderb verschworen bin. Sei es die Blut-und-Boden-Ideologie der Rechten oder sei es der Moralismus der Linken.
Darüber wird dann auch intern nicht mehr diskutiert, sondern die Welt wird in Freund und Feind eingeteilt. Freundschaft gibt es nur noch im Inneren meiner tribalen Gemeinschaft, meiner Community. Jeder, der auch nur einen Fußbreit neben meiner Meinung steht, ist dann „der Andere“, und gegen den muss man etwas tun.
Voraufklärerisches Freund-Feind-Denken
Das klingt so, als würden Sie eine Kapitulation vieler Menschen gegenüber den heutigen Widersprüchen beschreiben, gegenüber der Realität, die wir erleben.
Bernd Stegemann: Ich fürchte, in den Strukturen zeichnet sich immer mehr das Freund-Feind-Denken ab, was etwas Voraufklärerisches ist. Mit Feinden kann man bekanntlich keine Kompromisse mehr aushandeln. Und die gesamte Demokratie besteht ja darin, kollektiv bindende Entscheidungen herbeizuführen.
Aber kollektiv bindend heißt eben, dass auch diejenigen, die in einer Abstimmung unterlegen sind, trotzdem mit dem Abstimmungsergebnis ihren Frieden machen und sagen können: Ich bin zwar anderer Meinung, aber ich akzeptiere, dass die Mehrheit das jetzt so entschieden hat.
Trump hat den antidemokratischen Fundamentalismus auf den Punkt gebracht: „Ich akzeptiere das Wahlergebnis nur, wenn ich Präsident werde.“ Das ist der Inbegriff von Freund-Feind-Denken in der Politik. Allerdings, und das ist mir wichtig: Es ist eben nicht nur Trump! Es ticken immer mehr auf der anderen politischen Seite in dieser falschen, fatalen Logik.
Ich möchte gern über den Begriff „Identitäten“ mit ihnen sprechen. Sie sagen: „Es gibt in der öffentlichen Debatte eine schützenswerte Identität, zum Beispiel die Roma, und es gibt eine problematische Gruppe, zum Beispiel die Einwohner von Sachsen.“
Zugleich heißt es: „Alle Identitäten sind nur Konstruktionen, und wer sich eine sächsische Identität herbeikonstruiert, der macht sich eines gefährlichen Nationalismus schuldig.“
Bernd Stegemann: Identitätspolitik arbeitet mit Doppelstandards und das führt zu unlösbaren Problemen. Die eigene Identität ist immer besonders schützenswert und toll und darf darum mit allen Mitteln verteidigt werden. Wenn ein anderer aber etwas Ähnliches tut, dann ist das zu bekämpfen, weil der zum Beispiel ein böser Sachse ist und das nicht darf.
Das ist so offensichtlich widersprüchlich, dass ich nicht verstehen kann, wie sich das so unglaublich ausbreiten konnte. Es widerspricht dem einfachsten Verständnis von Universalismus und Gleichberechtigung, wenn man dem Einen zugesteht, er darf eine Identität haben, dem Anderen aber seine Identität vorwirft.
Also klassische Doppelmoral?
Bernd Stegemann: Ganz klassische Doppelmoral, und zwar schlimmster Ausprägung.
Das Deutschland-Paradox
In dem Zusammenhang beschreiben Sie auch das sogenannte „Deutschland-Paradox“: „Deutschland gibt sich kollektiv den Auftrag, kein Kollektiv mehr zu sein.“ Können Sie das kurz erläutern?
Bernd Stegemann: Das kommt aus der deutschen Geschichte. Die Deutschen haben einen übergroßen Schluck aus der Pulle des Nationalismus genommen, sind mit einem ganz schweren Kater aufgewacht und haben dann versucht, sich nicht mehr als Nation zu begreifen, sondern als eine Art Wirtschaftskraft. Ich rede hier natürlich von Westdeutschland. Das große Wirtschaftswunder hat allen eine neue Identität verliehen. Wir sind die Tollen, die so viele Autos bauen und exportieren. Das trägt bis heute.
Dass die deutsche Automobilindustrie in die Krise kommt, ist ja ein Trauma für die Deutschen. Auf der anderen Seite ist es bis heute hochproblematisch, eine Deutschlandfahne irgendwo hinzuhängen oder zu sagen, man sei Deutscher. Die Deutschen möchten am liebsten alle Europäer sein.
Dahinter verbirgt sich aber, und das meine ich mit dem Paradox, ein sehr starker machtpolitischer Anspruch der Bundesrepublik Deutschland, die EU ökonomisch zu dominieren.
Deutschland hat mit Hartz IV einen großen Niedriglohnsektor geschaffen und nutzt den Euro als unterbewertete Währung. Die Exportüberschüsse gibt es also nicht nur, weil die Deutschen so tolle Autos bauen, sondern vor allem, weil in Deutschland die Löhne so niedrig sind, und der Euro im Vergleich zu einer virtuellen D-Mark extrem unterbewertet ist. Deutschland kann so viel exportieren, weil es über eine Währung verfügt, die nicht der deutschen Wirtschaftskraft entspricht.
Ich würde gern noch einmal auf die Beziehung zur Identität zurück kommen. Sie schreiben im Buch, die Deutschen seien in ihrem Selbstbild in gewisser Weise doppelt Weltmeister, einmal moralisch, weil sie so extrem gründlich ihre Vergangenheit aufarbeiten und dann ökonomisch. Was macht das mit der deutschen Identität?
Bernd Stegemann: Die deutsche Identität interessiert mich eigentlich gar nicht. Mich interessiert die Funktion, die ihre paradoxe Form in der Politik erfüllt. Und diese Funktion ist eben eine ziemlich brutale.
Durch das, was ich eben beschrieben habe, sind wir innerhalb der EU die absolut stärkste Macht. Gleichzeitig nehmen wir für uns immer noch in Anspruch, dass wir die Oberlehrer sind, und allen anderen nicht nur erklären können, wie sie sich ökonomisch zu verhalten haben, siehe Griechenland, sondern auch, wie sie mit Flüchtlingen umzugehen haben, siehe Ungarn, Polen und all die anderen Länder.
Sprich, wir sind moralisch auf einem hohen Ross und ökonomisch auch, und leugnen zugleich, dass wir die Nutznießer einer sehr ungerechten EU-Politik sind, die uns immer hilft und den anderen schadet.
Kommen wir zu einem anderen Aspekt. Sie beschreiben einen „Sprachverlust“ bei den Verlierern des Systems, die sich nicht mehr äußern können und denen „die Sprache geraubt wird, mit der sie von sich und ihrer Not berichten können“. Können Sie das erläutern?
Bernd Stegemann: Das ist der gesamte Komplex der Political Correctness. Das ist ein Phänomen, das aus den Hochschulen kommt, den amerikanischen und inzwischen auch den deutschen, wo man davon ausgeht, dass das Böse in der Welt verschwindet, wenn man kränkende und böse Begriffe aus der Sprache eliminiert.
Das ist eine Art magisches, mittelalterliches Denken und darum wenig hilfreich.
Zugleich wird mit dieser Sprachregulierung Gewalt ausgeübt und Ungleichheit reproduziert.
Es gibt ein wunderbares Beispiel aus den USA, was das schön auf den Punkt bringt. Da sagt ein klassischer Trump-Wähler: Ihr in den liberalen Medien sagt immer, wir sollen nicht mehr „Neger“ sagen, aber „Redneck“ (Schimpfwort für wenig gebildete, konservative Weiße aus den Südstaaten; Anmerkung P.S.) wird ständig benutzt.
Auch wieder Doppelmoral?
Bernd Stegemann: Wieder die Doppelmoral. Bei einer Gruppe wird genau aufgepasst, welche Worte kränkend sein können. Und auf der anderen Seite heißt es, der Hartz-IV-Empfänger sei dumm, ungebildet, isst nur Chips, guckt Fernsehen und räumt den Aldi leer. Das kann man alles ungestraft sagen.
Wenn das aber nicht der Hartz-IV-Empfänger wäre, sondern der syrische Flüchtling, dürfte man es auf gar keinen Fall machen. Das ärgert mich. Ich will weder den Einen noch den Anderen diskriminieren. Beide sollen auch nicht gegeneinander ausgespielt werden.
„Ich kann nicht verstehen, wie man sagen kann, dass es keine Klassen mehr gibt“
Sie sagen, dass Hochqualifizierte, die nicht auf das Bildungs- und Gesundheitssystem ihres Heimatlandes angewiesen sind, oftmals die Fähigkeit verloren hätten, „die Gefühle ihrer Gemeinschaft zu teilen“.
Als Ausweg nennen Sie, dass diese Eliten reflektieren sollten, dass sie einen Klassenstandpunkt vertreten. Dazu müsste doch aber überhaupt erst einmal die Existenz von Klassen eingeräumt werden. Davon scheinen wir weit weg zu sein.
Bernd Stegemann: Ja, der Neoliberalismus hat es wunderbar hinbekommen, dass alle immer nur noch von Individuen sprechen, allenfalls noch von „Milieus“.
Es ist eines der größten strategischen Kampfziele gewesen, den Klassenbegriff zu zerstören.
Man muss sich darüber klar sein, dass der nicht von alleine abhandengekommen ist. Er ist planmäßig zerstört worden durch bestimmte Diskurse, die in die Soziologie und in die Ideologie eingeflossen sind.
In welcher Zeit ist das passiert?
Bernd Stegemann: Das fing in den 70er Jahren an. Es gibt von Didier Eribon einen tollen Text, der leider nur auf Französisch erschienen ist, der darüber geforscht hat, wie große Denkfabriken, aus den USA finanziert, überall Kongresse veranstaltet haben, um den Klassenbegriff sozusagen zu „widerlegen“ und als absurd hinzustellen. Bis heute wird mir in Kritiken immer wieder vorgeworfen, dass ich von so einem seltsam antiquierten Begriff wie „Klasse“ rede. Und man meint, diese Lächerlichkeit zeigen zu können, indem man sagt: Ja, wo sind denn hier die Arbeiter mit den schwarzen Gesichtern und den schmutzigen Fingernägeln, die zu Tausenden vor den Fabriktoren stehen?
Das ist ein absolut kitschiges, diffamierendes Bild von Klasse. Klasse hat nichts mit dem schmutzigen Fingernagel zu tun, sondern ist ein ökonomisches Verhältnis.
Alle, die nicht von der Rendite ihres Kapitals leben können, gehören einfach mal zur Klasse derjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Da gibt es natürlich große Unterschiede, große Privilegierungen und große Prekarisierungen, trotzdem ist das die Grundlage der Klassenfrage.
Über 40 Millionen Menschen in Deutschland gehen jeden Tag arbeiten. Ich kann nicht verstehen, wie man da sagen kann, dass es keine Klassen mehr gibt.
Sie sprachen gerade Didier Eribon an. Die FAZ veröffentlichte vor einiger Zeit einen Text von ihm, in dem er ebenfalls erwähnte, wie die Zerstörung des Klassenbegriffs planvoll von Denkfabriken aus Banker- und Unternehmerkreisen organisiert wurde. Tatsächlich waren auch westliche Geheimdienste in diesen Kulturkampf um die Begriffe involviert.
Vor wenigen Jahren wurde eine Studie der CIA von 1985 veröffentlicht, in der erfreut Bilanz gezogen wurde, wie französische Intellektuelle zunehmend auf US-Linie argumentieren würden und wie die Linke von innen heraus geschwächt worden sei. Das zeigt, welche machtpolitische Bedeutung solchen philosophischen Debatten beigemessen wird.
Aber bevor wir vielleicht gleich noch auf die Theorie kommen, die dahinter steht, zunächst noch einmal zurück zur Moral. Sie sagen: „Die Moral rückt in die Rolle des großen Anderen, der als Autorität dafür sorgt, dass sich die Guten nicht mit den unbequemen und bösen Teilen der Gesellschaft beschäftigen müssen.“
Der „große Andere“ sei Ausdruck einer „uneingestandenen Sehnsucht des postmodernen Menschen nach totalitärer Führung“. Die modernen Liberalen wünschen sich demnach eigentlich eine lenkende Autorität?
Bernd Stegemann: Mit Slavoj Žižek würde ich sagen, sie wünschen es sich, sie wissen es aber nicht. Natürlich würden sie das immer leugnen. Das ist klar. Auf der einen Ebene tun sie alles dafür, dass es das nicht gibt.
Aber eine vollends postmodernisierte Welt zerfällt in kleine, tribalistische, verfeindete Gemeinschaften, springt also hinter die Aufklärung zurück. Und genau so ist es auch im Diskurs zu beobachten.
Am Ende der ganzen Dekonstruktionsbemühungen steht dann plötzlich der „große Andere“ der Moral, der sagt: Deine Identität muss dekonstruiert werden, meine Identität muss geschützt werden. Das ist aus der Theorie nicht abzuleiten, sondern eine magische Wiederauferstehung der Moral.
Das ist irritierend für mich, denn wenn diese Leute die Mühe, die sie aufgewendet haben, um den Klassenbegriff auseinanderzunehmen, darauf verwenden würden, den Moralbegriff auseinanderzunehmen, dann würden sie womöglich etwas realistischer auf die Welt schauen können.
Postmoderne, Marktlogik und „ideologiefreie“ Welt
Stichwort Postmoderne, ein Begriff, mit dem manche vielleicht nicht viel anfangen können. Sie schreiben dazu: „Genau die Theorie, die dem Kapitalismus in den letzten 30 Jahren seine wichtigsten Impulse gegeben hat, gilt auch dem linken Denken seit fast 50 Jahren als fortschrittlichste Position.“ Sie erwähnen den französischen Philosophen Jean-François Lyotard, der 1979 meinte, es gebe keine große Erzählung mehr und die Realität sei in unendlich viele kleine Probleme zerfallen, die sich nicht mehr miteinander verbinden ließen. Solche Gedanken wurden damals, nach der 68er Zeit, von vielen als Erlösung von ideologischen Verkrampfungen empfunden und prägen die westliche Gesellschaft bis heute.
Sie sagen dazu: „Die ideologiefreie Weltanschauung der Postmoderne wurde zur neuen herrschenden Ideologie unserer Zeit.“ Das klingt paradox.
Bernd Stegemann: Eigentlich gar nicht. Am Anfang ist das postmoderne Denken ein Befreiungsschlag gewesen: Wenn man sagt, nicht mehr die große Erzählung des Sozialismus oder die große Erzählung der Religion bindet alles ein, sondern die Welt besteht aus einem Management von Ausnahmeproblemen.
Die negative Wendung kam dadurch hinein, dass das nicht im luftleeren Raum stattgefunden hat, sondern in kapitalistisch organisierten Gesellschaften. Das heißt, das Vakuum, das durch die Abschaffung der großen Erzählung entstand, ist gefüllt worden von der kapitalistischen Erzählung, also der Marktlogik.
Die Marktlogik hat dann das Management der Einzelprobleme übernommen und gesagt: Ab jetzt ist jeder Mensch seines Glückes Schmied, jedes Unternehmen kämpft gegen jedes andere.
Die Folge ist, dass seitdem alle im dauernden Wettbewerb miteinander stehen, die Schulen sind im Wettbewerb miteinander wie die Schüler, und so weiter.
Die Postmoderne war ein nachvollziehbarer, aber dann in seiner Wirkung verhängnisvoller Türöffner für die Durchkapitalisierung der Gesellschaft.
Seither, so heißt es in Ihrem Buch, „gilt jede Suche nach einer Bindung oder einem Zusammenhang als Zwang und böse“. Erklärt sich daraus vielleicht auch die pauschale Ablehnung gegenüber dem Begriff „Verschwörungstheorie“ in weiten Teilen der Gesellschaft?
Große Verschwörungen und geheime Absprachen Mächtiger gelten ja manchen als extrem unwahrscheinlich, da die Welt viel zu zersplittert und komplex sei.
Bernd Stegemann: Das Problem beim Verschwörungsbegriff ist, dass davon ausgegangen wird, dass es eine Gruppe von Verschwörern gibt, also ein Subjekt, was das tut. Das ist letztlich ein Holzweg. Es gibt nicht irgendwo ein paar alte Männer, die an irgendwelchen Telefonen hängen und die Welt regieren. Das ist ein falsches Bild. Die Verschwörung liegt auf einer systemischen Ebene.
Luhmann würde sagen, die Systeme selber sind süchtig geworden nach Rendite. Die Systeme selber reproduzieren immer wieder diese Zersplitterung des Menschen, die Entsolidarisierung und so weiter.
Das ist kein menschlicher Akteur, der das macht, sondern es ist in die Logik der Interaktion eingedrungen – wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen über Dinge sprechen, wie Argumente verwendet werden, wann Argumenten geglaubt wird und wann nicht.
Und darum versuche ich mit meinem Buch eine Art von Aufklärung zu betreiben. Ich möchte immer wieder auch im Kleinen zeigen: Schau mal, da steckt doch die Entsolidarisierung in der Formulierung drin!
Der Soziologe Zygmunt Baumann schrieb vor 20 Jahren: „Wenn die Zeit der Revolutionen, deren Objekt das System war, vorbei ist, dann deswegen, weil es heute kein Schaltzentrum mehr gibt, das die Revolutionäre stürmen könnten.“ Würden Sie dem zustimmen?
Bernd Stegemann: Man kann Google natürlich nicht angreifen, indem man eine Bombe auf die Google-Zentrale wirft. Das zerstört Google nicht. Das besagt die Netzwerk-Theorie. Aber es gibt natürlich immer noch Knoten in den Netzwerken. Zum Beispiel verteidigen sich die Kapitalinteressen momentan gegen Kritik, indem sie es hinbekommen haben, sich selber als moralisch höherwertige Instanz hinzustellen.
Das ist für mich so ein Knoten. Wenn man das einmal aufbricht und dadurch eine andere Erzählung möglich wird, dann verändert sich auch wieder etwas, da die Menschen plötzlich eine andere Perspektive auf die Realität bekommen.
Konzentriertes Eigentum und Arbeitszwang
Zum großen Rahmen und Hintergrund der Konflikte, über die wir hier sprechen, gehört die extreme Konzentration von Eigentum. Sie sagen, es gab ein „Ursprungsereignis des Frühkapitalismus“ im 16. Jahrhundert in England, als die Gemeindeäcker von mächtigen Adligen enteignet wurden und die Vertriebenen in der Folge in ein System des „Arbeitszwangs“ gerieten. Was geschah damals?
Bernd Stegemann: Das ist die berühmte Urgeschichte des Kapitalismus, die Karl Polanyi in „The Great Transformation“ beschrieb.
Also: Es gab eine große Nachfrage nach englischer Wolle aus Oberitalien. Da war viel Geld, die haben viel für die englische Wolle bezahlt. Daraufhin haben die englischen Adligen gesagt: Wir müssen mehr Wolle produzieren und darum müssen wir mehr Schafe halten. Mehr Schafe brauchen aber mehr Land, und um das zu bekommen, wurden die Gemeindeäcker eingezäunt und die Zäune mit Waffengewalt verteidigt. Es hieß: Das gehört jetzt den Schafen und nicht mehr den Menschen.
Es gibt aus dieser Zeit das berühmte Pamphlet „Schafe fressen Menschen“. Dadurch wurden viele Menschen ihres natürlichen, gemeinschaftlichen Lebensraumes beraubt. Sie wurden landlos, obwohl sie vorher keine Eigentümer waren, aber eben Teil einer Gemeinschaft, die Eigentum hatte. Sie zogen dann als Bettler, Vagabunden, Räubertruppen oder als Schauspieler durch das Land und sammelten sich zum Großteil in London. Dadurch entstand ein großes Lumpenproletariat aus rechtlosen, landlosen Menschen.
Als Reaktion darauf wurden dann die Arbeitshäuser gegründet, eine Mischung aus Wohltätigkeit und brutaler Disziplinierung. Das war eine große Bewegung in England: Arbeit als eine sinnlose Form der Bestrafung. Und daran dockte dann die Industrialisierung an. Die nutzte, mit der Erfindung der Maschinen, diese Arbeitskraft für renditeträchtige Unternehmen. Das ist die entscheidende Vorgeschichte für die Industrialisierung.
Mit bestehenden Gemeindeäcker-Strukturen hätte die Industrialisierung gar nicht funktioniert, weil niemand freiwillig in die Fabriken gegangen wäre.
Und da kann man vielleicht den Bogen zur Gegenwart schlagen.
Bernd Stegemann: Da fällt einem natürlich sofort der Niedriglohnsektor durch Hartz IV ein: Den Leuten wird eine Sicherheit weggenommen und dadurch werden sie gezwungen, sich in Arbeitsverhältnisse zu begeben, die sie sonst niemals angenommen hätten.
Am Ende Ihres Buches heißt es: „Die Argumente für den Liberalismus sind schal geworden, wenn mit ihnen gleichzeitig Menschenrechte und Kapitalrechte begründet werden.“ Sie sagen, unsere Zeit brauche „eine neue Aufklärung„. Ist das das eigentliche Projekt von „Aufstehen“?
Bernd Stegemann: (lacht) Ja, natürlich! Diese Refundamentalisierung ist verhängnisvoll. Man muss, glaube ich, niemandem erklären, dass eine Gesellschaft, in der die Spaltungen immer tiefer werden, nur noch Gewalt produziert. Und die Gewalt nimmt ja auch zu in den westlichen Gesellschaften.
Auf der anderen Seite gehen viele Erklärungsmuster in die falsche Richtung. Kapitalrechte werden mit moralischen Argumenten verteidigt, mit denen man eigentlich Menschen verteidigen müsste.
Und dann ist man natürlich auf einer schiefen Ebene: Reichtum und Armut klaffen immer weiter auseinander, von Jahr zu Jahr. Auch in Deutschland werden die Reichen jedes Jahr ein paar Prozent reicher, und das untere Drittel sinkt immer tiefer.
In Frankreich gehen seit einigen Wochen die Menschen auf die Straße, Stichwort Gelbwesten.
In Deutschland ist so etwas nicht abzusehen. Wie erklären Sie sich das?
Bernd Stegemann: (seufzt) Das ist sicherlich auch ein Temperamentsunterschied. Die Franzosen haben ja 1968 einen großen Generalstreik auf die Beine gestellt. Mit ihrer französischen Revolution im Hintergrund sind sie, glaube ich, ein ganz anders entflammbares Volk.
Wo würden Sie dann einen Weg für Deutschland sehen?
Bernd Stegemann: Ich glaube, solange diese schwarz-grüne Erzählung – „eigentlich ist der Kapitalismus eine prima Sache, wenn jeder Einzelne sich moralisch verhält“ – so dominant bleibt, ist es unmöglich, etwas zu verändern.
Solange es noch so viele gibt in den privilegierten Berufen, in den besseren Wohngebieten, Schulen und so weiter, die zugleich auch die Meinungsführerschaft haben in den Zeitungen, im Fernsehen und im Internet, solange dieses Milieu die Erzählung schreibt, also die „Robert-Habeck-Erzählung“, solange wird sich im Sozialpolitischen nichts verändern.
* Zu Paul Schreyer siehe hier:
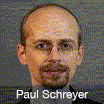
https://paulschreyer.wordpress.com/2017/01/26/in-eigener-sache-paul-schreyer-ken-jebsen-juergen-elsaesser-compact-und-die-querfront/
Über Kommentare auf meinem Blog hier würde ich mich freuen.
Jochen
 Der Dramaturg Bernd Stegemann gilt als einer der Köpfe hinter Sahra Wagenknechts linker Sammlungsbewegung „Aufstehen”.
Der Dramaturg Bernd Stegemann gilt als einer der Köpfe hinter Sahra Wagenknechts linker Sammlungsbewegung „Aufstehen”. „Aufstehen” war der Versuch, dieses Problem anzugehen.
„Aufstehen” war der Versuch, dieses Problem anzugehen.

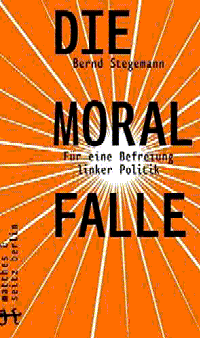
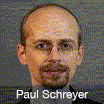
 Ein Gastbeitrag von Joachim Keiser auf der facebook-Seite von Jens Wernicke
Ein Gastbeitrag von Joachim Keiser auf der facebook-Seite von Jens Wernicke