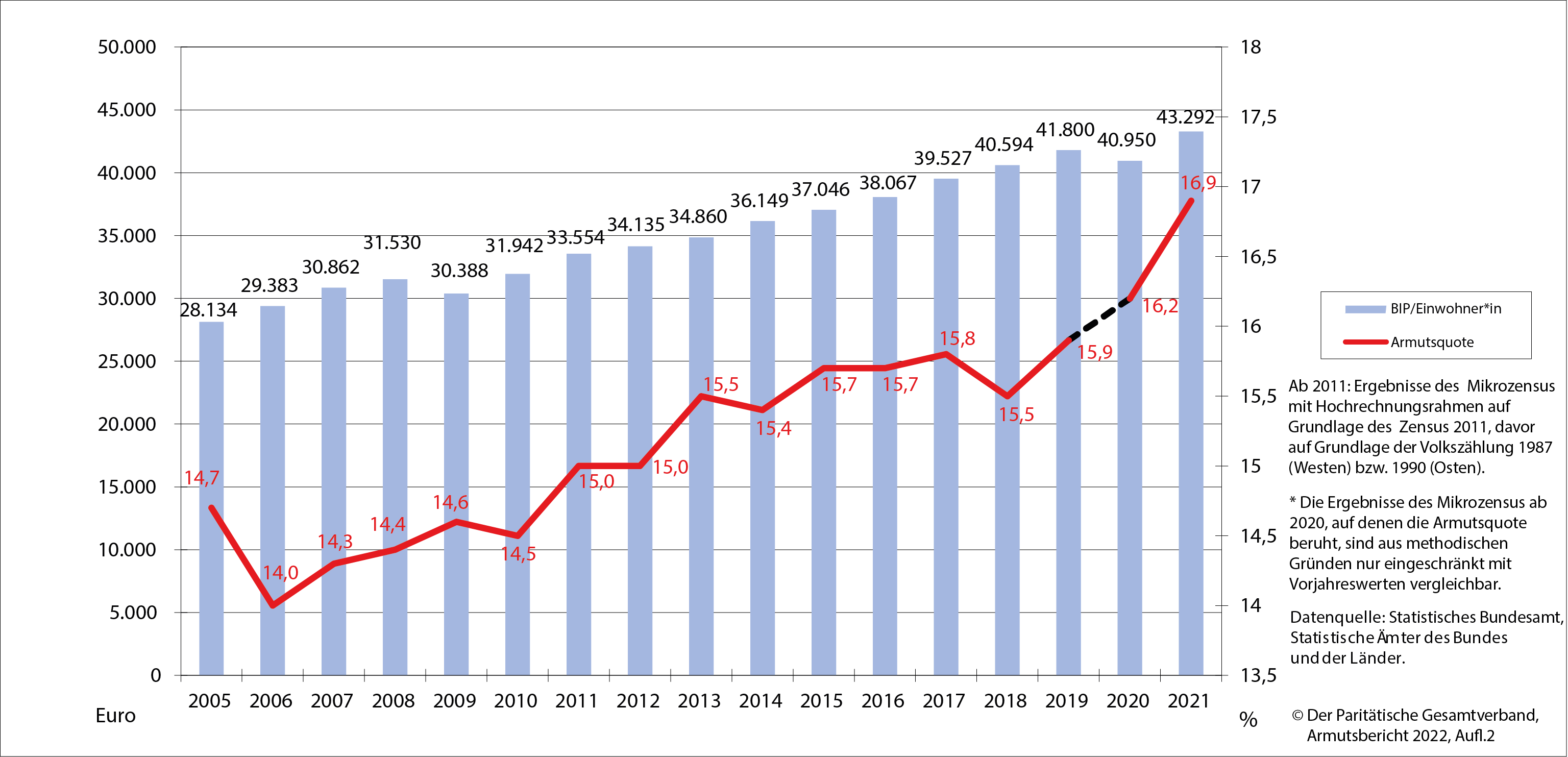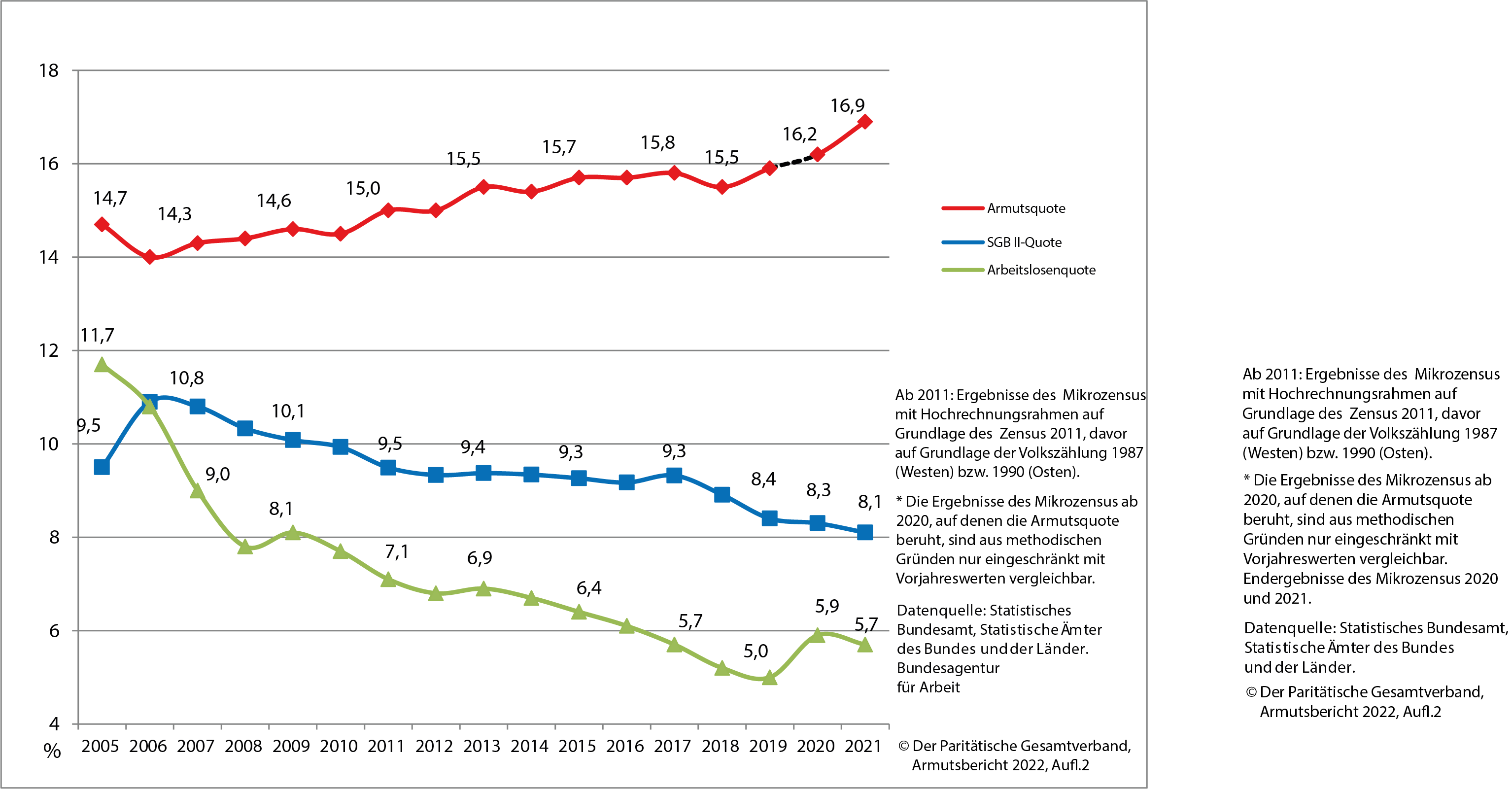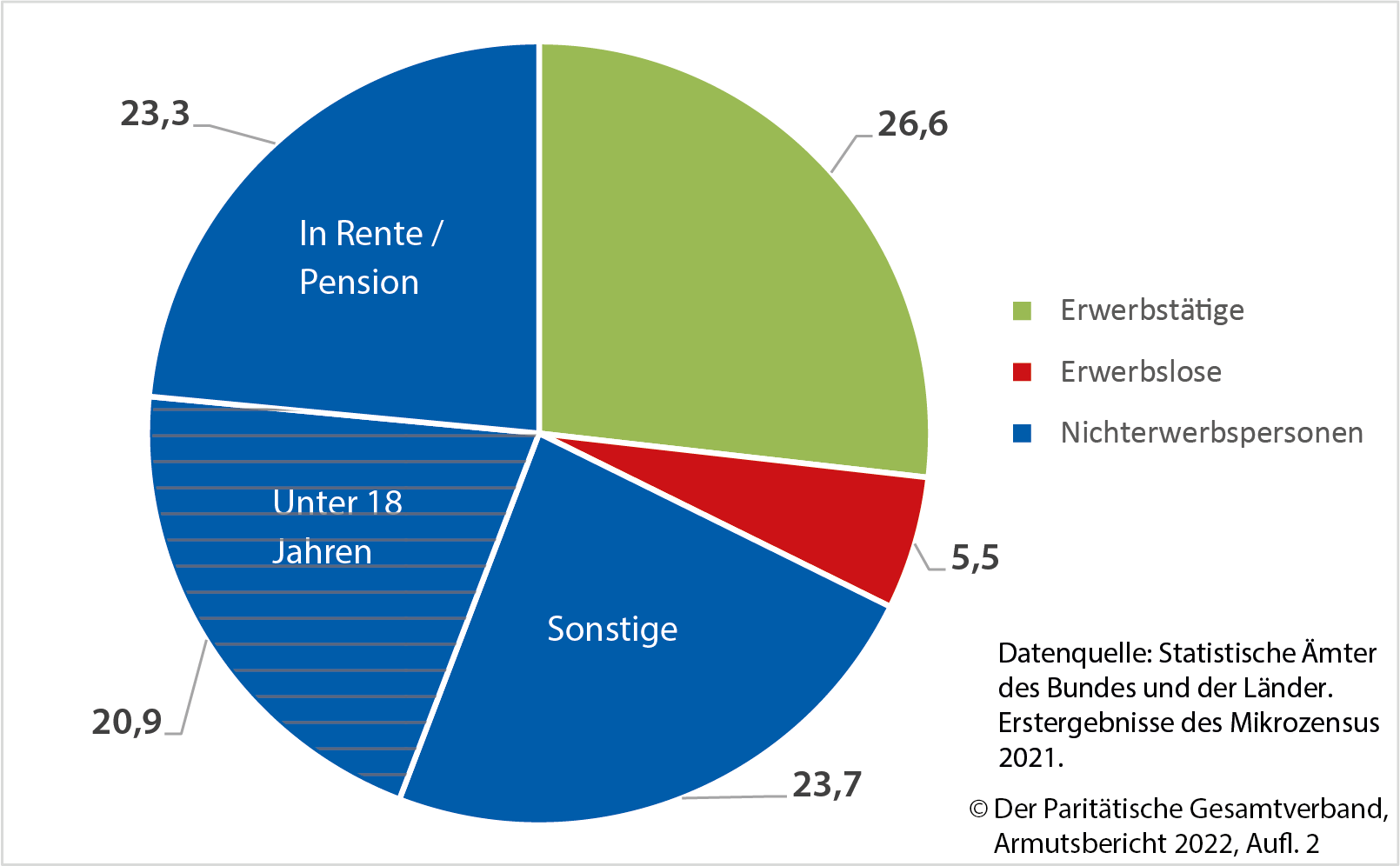Jochens SOZIALPOLITISCHE NACHRICHTEN
Erst einmal wünsche ich allen Lesern ein gesundes, friedfertiges und auskömmliches Neues Jahr.

th roeper
Innerhalb der Offenen Linken Ries hatten wir eine lebendige Diskussion anlässlich der Bauernproteste.
Heute hat der Journalist Thomas Röper einen längeren Artikel veröffentlcint mit vielen Querverweisen, die seine Interpretation belegen.
Wer die Bücher „Inside Corona“ und „Das Ukraine-Kartell“ gelesen hat, hat schon eine Grundlage, um das hie Präsentierte einzuordnen.
 Als weitere Grundlage sei das Buch „Schock-Strategie“ von Naomi Klein sowie die zahlreichen Blogeinträge von Norbert Häring empfohlen, z.B.:
Als weitere Grundlage sei das Buch „Schock-Strategie“ von Naomi Klein sowie die zahlreichen Blogeinträge von Norbert Häring empfohlen, z.B.:
https://norberthaering.de/macht-kontrolle/summit-of-the-future/ oder schon 2019 https://josopon.wordpress.com/2019/01/07/norbert-haering-tzum-migrationspakt-wie-die-konzerne-die-vereinen-nationen-unter-ihre-kontrolle-brachten/
Und hier auszugsweise der Artikel von Röper. Es lohnt sich, wenn man Zeit hat, den Links nachzugehen.
Die Bauernproteste, die derzeit Schlagzeilen machen, sind kein deutsches Phänomen, sondern ein Symptom einer im gesamten Westen umgesetzten Politik zur Umverteilung der landwirtschaftlichen Flächen von Kleinbauern an große Konzerne. Aber das ist nur ein Teil eines viel größeren Programms.
Bauernproteste sind bei weitem kein deutsches Phänomen, in den letzten Jahren gab es beispielsweise massive Bauernproteste in den Niederlanden. Der Grund dafür ist ein Plan der niederländischen Regierung, bis zu 3.000 Höfe zu schließen. Die niederländische Regierung bietet ihnen zwar über 100 Prozent des Wertes ihres Besitzes an, dafür müssen sie aber ein Berufsverbot in allen Ländern der EU akzeptieren. De facto ist das eine mit Geld versüßte Zwangsenteignung, gegen die die niederländischen Landwirte seit Jahren protestieren, denn wer sich weigert, der soll zwangsenteignet werden.
Das gewollte Höfesterben
Als Vorwand wird mal wieder der Kampf gegen den angeblich menschengemachten Klimawandel genannt. Bauernhöfe seien Produzenten von klimaschädlichen Abgasen und von Stickstoff, heißt es.
Auch in Belgien haben die Bauern immer wieder gegen für sie existenzgefährdende Regelungen protestiert, die oft von der EU vorgegeben werden.
Auch in Belgien gibt es ein Höfesterben, in den letzten 13 Jahren ist die Zahl der Höfe um 14 Prozent zurückgegangen.
In den Niederlanden ist die Zahl der Höfe von 2010 bis 2020 bereits um etwa ein Drittel zurückgegangen, was ein ähnlich starkes Höfesterben ist, wie in Deutschland.
Man könnte die Liste der Länder, in denen eine Politik umgesetzt wird, die auf eine zielgerichtete Reduzierung der Bauernhöfe abzielt, lange fortsetzen.
Die Methoden und die von den jeweiligen Regierungen vorgeschobenen Begründungen sind unterschiedlich, aber sie haben alle das gleiche Ergebnis: In westlichen Ländern sterben die kleinen Bauernhöfe und deren Land wird meist von den großen Lebensmittel- und Agrarkonzernen aufgekauft. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Bedingungen für die kleinen Betriebe Schritt für Schritt verschlechtert, um sie zum Verkauf ihres Landes zu drängen.
Die Kürzungen, gegen die die deutschen Bauern derzeit protestieren, fügen sich dabei in das Gesamtbild ein, das man in fast allen Ländern des kollektiven Westens beobachten kann. Und auch die deutsche Regierung, namentlich Bundesumweltminister Özdemir, arbeitet daran, die Zahl der von Bauern gehaltenen Nutztiere zu verringern, was ebenfalls in den meisten westlichen Länder das Ziel ist.
Die niederländische Regierung will die Zahl der gehaltenen Nutztiere gar um bis zu 50 Prozent reduzieren.
Das Phänomen kann man auch in den USA beobachten, wo das Höfesterben allerdings bisher langsamer abläuft. Im Jahr 2000 gab es in den USA 2,167 Millionen Farmen. 2022 lag die Zahl der Farmen schon bei nur noch 2,003 Millionen.
Das ist zwar ein langsameres Höfesterben als in Europa, aber es ist der gleiche Trend.
Weg vom Fleisch, hin zu Insekten?
Auch die WHO fühlt sich inzwischen berufen, über das Thema zu sprechen und natürlich ist der Vorwand wieder der Klimawandel. Die Nahrungsmittelproduktion trägt laut WHO-Chef Tedros Ghebreyesus zu über 30 Prozent der Treibhausgasemissionen bei und ist für fast ein Drittel der weltweiten Krankheitslast verantwortlich. Daher müsse die Nahrung weltweit umgestellt werden. Die Welt müsse weg vom Fleischverzehr und hin zu mehr pflanzlicher Nahrung. Außerdem wirbt die WHO für Insekten als Lebensmittel und für im Labor gezüchtetes Fleisch.
Auf dem jüngsten Klimagipfel COP28 veröffentlichte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) Ernährungsempfehlungen für die Länder der ersten Welt, um die CO2-Emissionen zu senken.
Die Botschaft an die wohlhabenden Länder lautete wieder, weniger Fleisch zu essen.
Mit gutem Beispiel mochten die versammelten Teilnehmer des Klimagipfels aber dann doch nicht vorangehen, denn auf der Speisekarte des COP28-Gipfels fand sich eine reiche Auswahl von Gerichten wie „saftige Fleischscheiben“, „saftiges Rindfleisch“, Wagyu-Burger, afrikanisches Straßen-BBQ, Philly-Cheesesteaks und anderer Fleischgerichte. Geröstete Insekten, Mehlwurmsuppe oder ähnliches suchte man hingegen vergeblich. Offenbar gelten die Ernährungsempfehlungen nur für das Fußvolk, nicht jedoch für die politische Elite.
Das ändert aber nichts daran, dass diese „Ernährungsumstellung“ von den westlichen Ländern vorangetrieben wird. Es sei nur daran erinnert, dass die EU immer mehr Insekten als Beimischung für Nahrungsmittel zulässt.
SDG: Die Agenda 2030
Über die sogenannten „nachhaltige Entwicklungsziele“ der UNO (Sustainable Development Goal, SDG) habe ich schon öfter geschrieben. Die SDG werden auch Agenda 2030 genannt, weil sie Ziele definieren, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Die dort genannten Ziele, zum Beispiel den weltweiten Hunger abschaffen, klingen alle sehr positiv. Wer jedoch in die Programme zur Umsetzung der SDG schaut, der versteht, dass das keineswegs positive Programme sind.
Ich habe im August beispielsweise über die C40-Städte berichtet, ein Programm, das ebenfalls ein Teil der Umsetzung der SDG ist.
Eine Auswahl der Ziele, die die C40 bis 2030 erreichen wollen, sind folgende verbindliche Regeln für die Bewohner der C40-Städte:
Null Kilogramm Fleischkonsum, Null Kilogramm Milchprodukte, maximal drei neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr,
Null private Fahrzeuge im Besitz, ein Kurzstreckenflug (weniger als 1500 Kilometer) alle drei Jahre pro Person.
Das ist kein Scherz, wie Sie hier mit allen Quellen nachlesen können.
Die Agenda 2030 umfasst praktisch alle Lebensbereiche und die Umsetzung der Agenda wird massiv gefördert. Lobbyiert werden die Ziele von den Stiftungen der sogenannten „Philanthropen“, also der westlichen Oligarchen, die mit ihren Reichtum die Politik der westlichen Staaten bestimmen.
Diese Oligarchen haben dabei konkrete Ziele, unter anderem die Kontrolle über den Agrar- und Lebensmittelsektor zu bekommen.
Damit würden sie den Staaten die Kontrolle über die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln abnehmen. Und genau das erleben wir gerade in der EU, denn wenn die Höfe sterben und deren Land an die Agrarkonzerne geht, bekommen wenige Konzerne die Kontrolle über die Lebensmittelmittelproduktion. Die EU-Staaten begeben sich auf einem weiteren Gebiet in die Abhängigkeit einiger weniger Superreicher.
Eben diese superreichen Globalisten kaufen seit Jahren weltweit Ackerland und nutzen ihren Einfluss auf die Politik, um die Regelungen für Landwirte so unerfüllbar und kostspielig wie möglich zu gestalten, damit kleine und mittlere Betriebe früher oder später pleite gehen, oder sogar vom Staat gezwungen werden, ihren Betrieb aufzugeben, siehe Niederlande. Das ist genau das, was wir in in der EU gerade beobachten.
Und auch die aktuellen Streichungen der Steuererleichterungen für deutsche Landwirte fügen sich als weiterer, wenn auch nicht so offensichtlicher, Schritt in das Bild.
Wie die „Philanthropen“ mit den SDG Geld machen
Die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) beeinflusst die deutsche Agrarpolitik über von ihr kontrollierte Projekte. Das System nennt sich öffentlich-private Partnerschaft (public-private partnership, kurz ppp) und funktioniert immer nach dem gleichen Muster. Die Stiftung eines westlichen Oligarchen, von den Medien liebevoll „Philanthrop“ genannt, schiebt ein Projekt an, finanziert es mit einigen Millionen, danach sind die westlichen Regierungen davon ganz begeistert und steuern ein Vielfaches (oft sogar das hundertfache) an Steuergeldern bei.
Diese Gelder kontrolliert damit der Oligarch, der das Projekt aus der Taufe gehoben hat. Zur Umsetzung solcher Projekte muss immer irgendetwas gekauft werden (Impfstoffe, Medikamente, Saatgut, etc.) und natürlich werden diese Dinge dann bei Firmen gekauft, an denen der Oligarch beteiligt ist oder die ihm ganz gehören.
Mit einem relativ kleinen finanziellen Einsatz lenkt der Oligarch also ein Vielfaches an Steuergeldern in seine eigene Tasche.
Aufgrund dieses eigentlich sehr einfachen Geschäftsmodells werden die sogenannten „Philanthropen“ immer reicher, während sie angeblich ihr Geld mit vollen Händen verschenken, um die Welt zu retten.
Dass die sogenannte Philanthropie in Wahrheit nichts weiter als ein Geschäftsmodell ist, habe ich in meinem Buch „Inside Corona“ ausführlich und mit vielen konkreten Beispielen aufgezeigt.
Um beim Beispiel Bill Gates zu bleiben: Die deutsche Bundesregierung finanziert 31 Projekte und Programme, an denen die Gates-Stiftung beteiligt ist. Bei 24 der Projekte ist die Gates-Stiftung der einzige Partner. Das wurde im Sommer 2023 durch eine kleine Anfrage der Fraktion der Linken zur Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und privaten Stiftungen bekannt.
Insgesamt überweist der deutsche Steuerzahler dafür 3,8 Milliarden Euro an die Stiftung von Bill Gates, wobei 3,35 Milliarden direkte, nicht projektgebunde Förderungen sind.
Die Gates-Stiftung hat sich als wichtigste Ziele die Gesundheit (also beispielsweise Impfungen), Ernährung (wobei massiv genmanipulierte Lebensmittel lobbyiert werden) und Bildung gesetzt.
Bildung ist deshalb so wichtig, weil die „Philanthropen“ de facto auch über den Inhalt der Lehrbücher bestimmen, die an westlichen Schulen und Universitäten benutzt werden. Was man den Kindern von heute in der Schule beibringt, ist das, was die Erwachsenen der nächsten Jahrzehnte denken werden.
Daher war es in nur wenigen Jahrzehnten möglich, die Werte der westlichen Gesellschaften massiv zu verändern.
Vor 50 Jahren war die Familie noch der wichtigste Wert im Westen, heute wurde das durch alle möglichen Lebensgemeinschaften und LGBT ersetzt.
Auch das ist gewollt, denn wenn man den familiären Zusammenhalt, also die gewachsenen sozialen Bindungen zerstört, macht man die Menschen einsam und leichter lenkbar.
Aus diesem Grund werden in den (ebenfalls von den Oligarchen bezahlten) westlichen Medien auch Singledasein, Kinderlosigkeit und wechselnde Partnerschaften, am besten auch noch mit wechselnden Geschlechtern, propagiert.
Und aus diesem Grund haben diese Dinge auch Einzug in die Lehrpläne an westlichen Schulen und Universitäten gehalten: Es ist das, schon von den alten Römern erfundene, simple und wirksame Herrschaftsinstrument „teile und herrsche“, das damit zur Perfektion gebracht wird.
Die angebliche Bekämpfung des Hungers als Geschäftsmodell
Aber kommen wir zurück zur Ernährung und zur Landwirtschaft, um die es hier gehen soll.
Und bleiben wir wieder bei Bill Gates, dessen Beispiel ich symbolhaft für die westlichen Oligarchen anführe.
Bill Gates ist inzwischen der größte private Inhaber von Ackerland in den USA. Bill Gates ist in vielen Ländern auf die eine oder andere Weise im Agrarsektor aktiv, laut der schon genannten Anfrage der Linken hat die Gates-Stiftung mittlerweile ein Volumen in Milliardenhöhe im deutschen Agrarsektor
Bill Gates ist finanziell mit dem berüchtigten Agrarkonzern Monsanto verknüpft, in diesem Zusammenhang ist es in Indien und Mexiko zur Übernahme von Ackerland gekommen.
Über die Verbindungen von Gates und Monsanto habe ich auch in „Inside Corona“ berichtet, dabei ging es um das Beispiel eines gemeinsamen Projektes von Gates und Rockefeller in Afrika, das ebenfalls mit viel Steuergeld der westlichen Staaten finanziert wurde und den Hunger bekämpfen sollte. Dabei wurden afrikanische Bauern gezwungen, auf genmanipuliertes Saatgut von Monsanto umzusteigen und so in die Abhängigkeit von Monsanto getrieben, woran Gates und Rockefeller dann verdient haben.
Nur das offizielle Ziel, die Erträge der Bauern zu erhöhen und so den Hunger in der Region zu bekämpfen, wurde leider nicht erreicht.
Überhaupt fragt man sich, wie der Westen den Hunger bekämpfen will, wenn er eine Politik macht, die kleine Bauern zum Aufgeben zwingt und den Agrarsektor so den großen Konzernen und Oligarchen in die Hände spielt.
Konzerne sind bekanntlich keine gemeinnützigen Organisationen, die den Hunger bekämpfen wollen, sie wollen Geld verdienen.
Wenn die Agrar- und Lebensmittelindustrie von kleinen und mittleren Betrieben an wenige Großkonzerne umverteilt wird, dann entsteht eine Marktmacht, die die kleinen Betriebe nie hatten. Und solche Konstellationen, in denen einige wenige Player einen Markt kontrollieren, führen bekanntlich nicht zu sinkenden Preisen, sondern zu Preisabsprachen und damit zu steigenden Preisen.
Bayer hat Monsanto inzwischen geschluckt, wobei beide sich dadurch auszeichnen, dass sie seit Jahren andere Agrarkonzerne aufkaufen. Das ist genau die Konzentration von Marktmacht in sehr wenigen Händen, über die ich hier geschrieben habe.
Es laufen also Prozesse, um im Lebensmittelbereich Monopole oder Oligopole zu bilden, was faktisch die Macht über die entsprechenden Märkte bedeutet.
Beispiel Ukraine
Die Ukraine ist ein gutes Beispiel dafür, wie solche Pläne umgesetzt werden.
Wenn landwirtschaftliche Betriebe pleite gehen, kann deren Land billig aufgekauft werden. Der vom US-geführten Westen kontrollierte IWF hat der Ukraine 2020 als Bedingung für weitere Kredite diktiert, sie müsse den Ausverkauf der Schwarzerde, der fruchtbarsten Böden der Welt, an Ausländer gesetzlich erlauben.
Offiziell gab es diverse Beschränkungen, aber die Gesetze wurden so gemacht, dass sie über Strohleute und verschachtelte Firmenkonstruktionen leicht zu umgehen waren.
So kam es in der Ukraine, einem der größten Getreide-Exporteure der Welt, zu einem massiven Landgrabbing, bei dem einige wenige, meist US-amerikanische Investoren massenhaft landwirtschaftliche Flächen zu einem Spottpreis eingekauft haben.
Dass das Land zu niedrigen Preisen zu kaufen ist, macht unter anderem der Krieg in der Ukraine möglich.
Neben Monsanto waren auch deutsche Unternehmen am Landgrabbing in der Ukraine im großen Stil beteiligt. Auch die Geflügelfleischproduktion in der Ukraine ist in der Hand internationaler Großinvestoren.
Die Ukraine könnte auch für den Anbau von Soja interessant sein. Der Krieg, der Land billig macht, ist ein Lottogewinn für die Aufkäufer.
Deren Ziel ist es, das (möglichst weltweite) Nahrungsmittelmonopol zu erlangen, indem ihnen sowohl das Ackerland gehört, als auch, indem sie (siehe Monsanto und andere Konzerne) die Kontrolle über Saatgut, Düngemittel und Pestizide erlangen.
All diese Macht konzentriert sich in nur sehr wenigen Händen, denn die Politik der westlichen Regierungen befördert den Prozess der Konzentration der Aktiva, indem sie die Bedingungen für kleine und mittlere Bauern immer mehr verschlechtert, sodass sie über kurz oder lang zum Verkauf ihrer Höfe gedrängt werden.
Sogar die explodierten Energiepreise in Europa spielen dem in die Karten, denn dadurch ist die Düngemittelproduktion in der EU de facto unrentabel geworden, was viele Mittelständler dazu zwingen könnte, ihre Betriebe billig an große Konzerne zu verkaufen, wenn sie nicht pleite gehen und alles verlieren wollen.
Die EU begründet ihre Sanktionen gegen russisches Öl und Gas, die die Preisexplosion verursacht haben, mit den Ereignissen in der Ukraine. Nur hat nicht Russland die Preise erhöht oder die Lieferungen nach Europa eingestellt, sondern das waren die Sanktionen des Westens.
Es sind also nicht die Ereignisse in der Ukraine an den hohen Preisen Schuld, sondern die Reaktionen der EU darauf.
Man sieht, dass die Ereignisse in der Ukraine für die entsprechenden westlichen Konzerne und Oligarchen aus vielen Gründen nützlich sind, denn davon profitiert nicht nur westliche die Rüstungsindustrie, sondern auch beispielsweise die westliche Lebensmittelindustrie.
Die SDG und die Oligarchen
Auch bei den SDG, also der Agenda 2030, ist eines der Kernthemen die Landwirtschaft. An den Treffen, bei denen darüber gesprochen wird, dominieren von durch Bill Gates, George Soros oder andere Oligarchen wie Rockefeller oder Ford finanzierte NGOs.
Die Finanzierung der Organisatoren der Treffen, auf denen über den Stand der Umsetzung der Agenda 2030 gesprochen wird, wird oft verschleiert. Als Beispiel nenne ich das World Food Forum, das unter anderem mit UN Women zusammenarbeitet.
Und UN Women wird finanziert von Bill Gates, George Soros, der Ford Foundation, Rockefeller und anderen üblichen Verdächtigen.
Ich habe auch dieses Prinzip der verschleierten Finanzierungen in „Inside Corona“ mehrmals aufgezeigt.
Um den Eindruck zu erwecken, es wären ganz viele Organisationen, die solche Projekte unterstützen, finanzieren die Oligarchen vielen Organisationen. Dabei werden Finanzströme auch gerne über zwischengeschaltete Organisationen gelenkt, um zu verschleiern, dass es in Wahrheit nur einige wenige Oligarchenstiftungen sind, die ein Ziel fördern.
In diesem Artikel kann ich das Thema nur sehr oberflächlich ansprechen, weil es so umfangreich ist, dass man darüber ein ziemlich dickes Buch schreiben kann.
Man müsste die 17 SDG und ihre Unterpunkte und die Programme anschauen, mit denen die jeweils umgesetzt werden. Da kommt man auf über 200 Programme, die man sich anschauen muss.
Alleine die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, mit der sie die SDG umsetzen will, umfasst aktuell 391 Seiten.
Aber eines macht schon dieser Artikel deutlich, nämlich dass internationale Organisationen und ihre Projekte von den Stiftungen einiger weniger Oligarchen (z. B. Gates und Soros) oder Oligarchen-Clans (z. B. Rockefeller und Ford) kontrolliert werden, und dass sie die Gelder, die die westlichen Regierungen in diese Projekte pumpen, kontrollieren und zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil einsetzen.
Damit bestimmen nicht gewählte, aber dafür profitorientierte, Personen über die Politik des Westens, die er der Welt aufzwingen möchte.
Was in der Landwirtschaft passiert, ist nur ein Beispiel. Ich habe vor einger Zeit schon anhand des Green Deal der EU aufgezeigt, dass es auch dabei nur darum geht, Steuergeld an eine Gruppe von Oligarchen zu lenken.
Auch bei Covid ist es so gelaufen, damals sind die Milliarden, die die EU für den Kampf gegen die „Seuche“ eingesammelt hat, praktisch komplett an Organisationen gegangen, die Bill Gates kontrolliert.
Übrigens wird Bill Gates auch Herr über die Daten der Menschen in der EU werden, was die digitalen Impfpässe ermöglicht haben, und Ursula von der Leyen preist dieses Konzept der „digitalen Identität“ bereits als Vorbild für den Rest der Welt an.
Und das waren auch nur Beispiele, die Liste ließe sich fortführen.
Digitale Identitäten
Kommen wir zurück zu den Bauerprotesten: Es geht nicht um ein paar Subventionen für Agrardiesel, es geht um ein systemisches Problem und um eine ernsthafte Gefahr für Freiheit und Wohlstand, siehe die C40-Städte mit ihrer Forderung, zukünftig ohne Fleisch, neue Kleidung, eigene Autos und sogar Flugreisen zu leben.
Und das sind keine wirren Fantasien von mir, diese Dinge werden mit viel Geld und großer Konsequenz umgesetzt.
Die „digitale Identität“, die Ursula von der Leyen so anpreist, wird dabei das ultimative und allumfassende Kontrollinstrument.
Auch das ist Teil der SDG, denn SDG Nummer 16 lautet „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“, wogegen eigentlich niemand etwas haben kann.
Eines der Unterziele, mit denen das erreicht werden soll, trägt die Nummer SDG 16.9 und lautet „Bis 2030 Schaffung einer legalen Identität für alle, einschließlich Geburtsregistrierung“.
Und daran arbeitet übrigens wieder Bill Gates, der dazu diverse Organisationen unterstützt, um Herr über diese digitalen Identitäten zu werden. *)
Eine der Organisationen nennt sich Modular Open Source Identity Platform (MOSIP) und die Gates Foundation rühmt sich, diese Plattform den Ländern der Welt ganz umsonst zur Verfügung zu stellen. Nur, dass Gates dann der Herr über all die Daten ist.
Eine andere Organisation, die von Gates und Rockefeller kontrolliert wird, heißt ID2020.
ID2020 hat für die (ebenfalls von Gates kontrollierte WHO) den Leitfaden für digitale Impfpässe erarbeitet, der die Grundlage für von der Leyens Projekt der digitalen Identität für EU-Bürger ist. **)
Die wird in der EU bereits eingeführt. Dabei handelt es sich um die elektronische Patientenakte. Nach deutschem Recht kann man der elektronischen Patientenakte widersprechen, aber da EU-Recht über nationalem Recht steht, sollte man bedenken, dass das Widerspruchsrecht der Patienten gegen die elektronische Patientenakte im entsprechenden EU-Gesetz entfallen soll. ***)
Das Finale rückt näher
So werden solche Dinge durch die Hintertür eingeführt. Die Probleme der Landwirte sind nur ein sehr kleiner Mosaikstein eines viel größeren Projektes, das die Welt, so wie wir sie kennen, komplett verändern wird.
Zumindest in den Ländern, in denen es umgesetzt wird, also im kollektiven Westen.
Ob der Rest der Welt mitspielen wird, ist fraglich.
Hier dürfte die im Mai 2024 anstehende 77. WHO-Gesundheitsversammlung interessant werden, denn dort wird über ein weiteres der dazu gehörenden Projekte abgestimmt. Es geht um die Änderung des Internationalen Gesundheitsvorschriften (International Health Regulations, IHR) und den neuen Pandemievertrag der WHO, die der von Gates kontrollierten WHO vollkommen neue Machtbefugnisse geben soll.
Darauf jetzt auch noch einzugehen, sprengt den Rahmen, bei Interesse können Sie hier nachlesen, worum es dabei geht.
Aber in jedem Fall sollten wir uns den Mai im Kalender vormerken und beobachten, was die WHO-Gesundheitsversammlung entscheidet.
*: https://josopon.wordpress.com/2022/08/04/gigantische-datenbank-soll-in-europa-nach-anforderungen-der-usa-entstehen-ibis-rockefeller-und-gates-foundation-machen-mit/
**: https://josopon.wordpress.com/2021/08/22/rustungskonzern-thales-will-impfprivilegien-und-passe-als-fur-das-ausrollen-mobiler-digitaler-identit-atsnachweise-nutzen/
***: https://josopon.wordpress.com/2022/02/10/alp-traume-des-weltwirtschaftsforums-werden-wahr-mit-impfpass-und-digitaler-patientenakte-zur-luckenlosen-uberwachung/
Die Leim-Medien schweigen sich über solche Zusammenhänge aus; wer darauf hinweist, riskiert die Ettikettierung als Verschwörungstheoretiker.
Angesichts solcher Planungen sind Hinterzimmer-Konvente von AfD-Funktionären mit Identitären und der „Werte-Union“ wie auch der geplante „Rollator-Putsch“ zwar ärgerlich, aber nahezu bedeutungslos.
Die französische Regierung wird jetzt von einem neuen „Global Leader“ aus Schwabs Denkfabrik angeführt – der kann sich gleich mit Baerbock auf die Hollywoodschaukel setzen.
Über Kommentare auf meinem Blog hier würde ich mich freuen.
Jochen



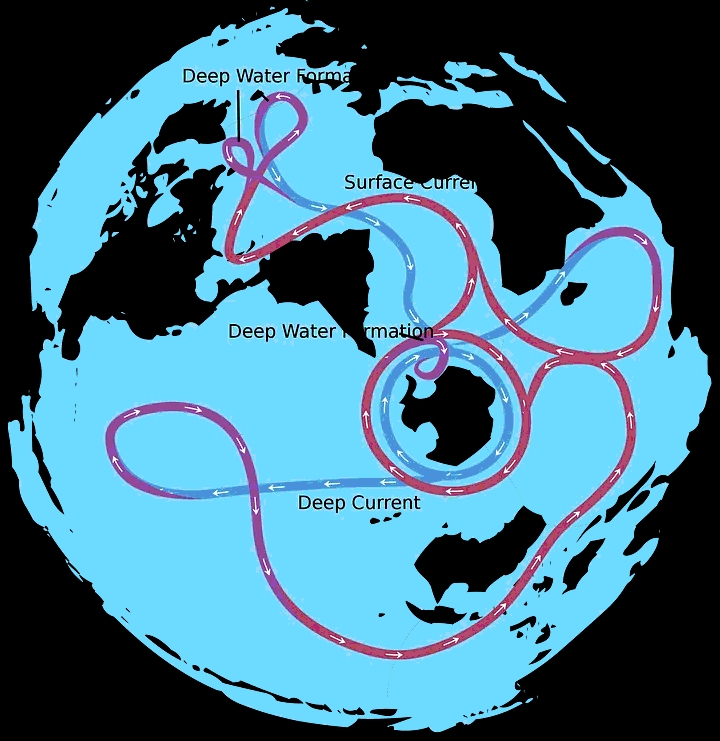
 Ich hoffe, dass sich noch viele Gewerkschafter und andere Friedensfreunde dazu entschließen, den Aufruf zu unterschreiben !
Ich hoffe, dass sich noch viele Gewerkschafter und andere Friedensfreunde dazu entschließen, den Aufruf zu unterschreiben !

 Inwiefern diese Forderungen im politischen Washington diskutiert werden, zeigt sich an einem online-briefing unter dem Titel:
Inwiefern diese Forderungen im politischen Washington diskutiert werden, zeigt sich an einem online-briefing unter dem Titel:
 Und wieder einmal weise ich auf das Buch von Thomas Röper hin:
Und wieder einmal weise ich auf das Buch von Thomas Röper hin: